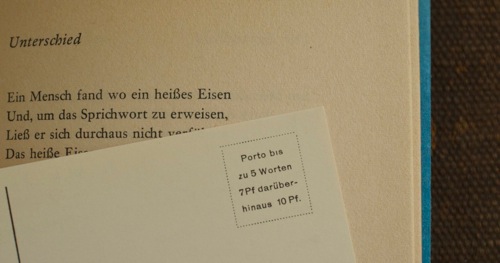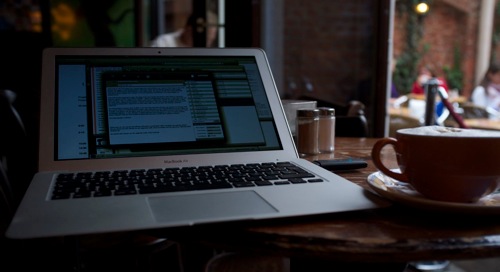Wenn ich mich zurück erinnere, sehe ich zwei Küchen, in denen ich jahrelang saß: Da ist zum einen die Küche im Haus meiner Eltern, seinerzeit modern eingerichtet mit Schränken in einem Grünton, der aus der Zeit stammte vor meiner Geburt. Es gab ein mehrbändiges Kompendium mit Rezepten, dessen Buchrückenbeschriftung ich noch immer aufsagen kann. (Sprich mich darauf an, wenn wir uns das nächste Mal sehen.) Zum anderen sehe ich die Küche meiner Großeltern, in der ich ein regelmäßiger Gast gewesen bin zu Zeiten der Mittel- und Oberstufe im Gymnasium unserer Stadt. Beide hatten miteinander gemein, dass sie zum Wohnraum hin geöffnet waren, lange bevor Einrichtungszeitschriften diesen Trend in die breite Masse trugen, in Städte wie Frankfurt oder Berlin, in denen man umgehend das Alte herausriss und ersetzte durch in Küchenstudios entworfene Orte mit Klarlackschranktürdesign. Zu dieser Zeit nahm ich die Speisen in höchster Eile zu mir, nicht um diesen Orten zu entfliehen – das jedenfalls war nie der Grund. Ich kann mich jedoch an an keinen Moment erinnern, in dem ich bewusst in der Küche saß, jemanden zu treffen, weil andere dort gewesen sind.

Zwei andere Küchen wurden in den Jahren danach viel wichtiger als jene, in denen ich als Jugendlicher aß. Erst viele Jahre später in Marburg wurde mir jene im Grimm-Haus lieb, genau genommen ein kleiner Raum, in dem wir speisten und tranken, weil die Küche sehr klein gewesen ist. Trotzdem habe ich mehrere Abende im Kopf, an denen wir sogar vor der Küchentür saßen im Flur, weil man sich dort naturgemäß traf. Andere standen vor dem kleinen Herd und kochten mit Resten, die einem eine Bäuerin für wenig Geld auf dem Markt überließ. Und ich erinnere das alte Haus am Ufer des Chiemsees, das in wenigen Räumen einen Ofen besaß. Man weilte im Winter stattdessen am Herd, der eine angenehme Wärme verstrahlte.
Daran also musste ich denken, als ich diese dreiviertelstündige Dokumentation eben sah, über einen Menschen, den ich sehr beeindruckend finde. Das Internet jedoch würde ich nicht aufgeben wollen, die Empfehlung kam schließlich hierüber von Lu.Â

Manchmal Abends, nach Tagen wie diesen, liege ich im Bett und denke an G. Ich denke daran, wie und warum ich ihn schätze, durch was für einen Zufall wir uns trafen (oder besser: er mich). Ich denke an alles was kam in den Jahren danach, schließlich warum ich hier sitze, wie ich bin und mit wem. Dann merke ich, dass ich die Stimme, die sagt »das kannst Du nicht machen!« von Monat zu Monate leiser vernehm‘.

Ich weiß genau, wovon ich träume, wenn ich mich sehe in wenigen Jahren. Doch gibt es einen Teil meines Lebens, der ist mir noch nicht völlig klar; den sehe ich nicht. In Gedanken versunken, an Abenden wie jenen eben erwähnten, blitzt er manchmal hervor. Dieser Teil meines Lebens ist noch unterwegs. (Im anderen als dem üblichen Sinn.)